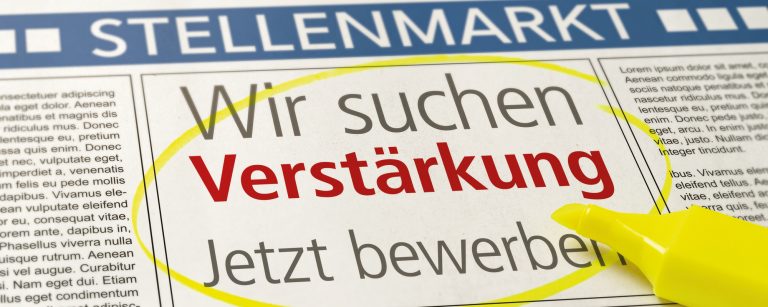Flexible Arbeitszeiten: Gleitzeit und Vertrauensarbeit in Österreich
Arbeitnehmer verlangen heute nach flexiblen Arbeitszeitmodellen. Ob Home Office, Gleitzeit oder unterschiedliche Remote-Modelle: Die Lösungen müssen sowohl den Bedürfnissen der Arbeitnehmer als auch den betrieblichen Anforderungen gerecht werden. Welche Modelle sich in Österreich besonders etabliert haben, und wie diese Modelle aussehen? BetterJobs hat alle Fakten.
Wenn es um flexibles Arbeiten und freie Zeiteinteilung geht, haben sich in unserem Land mehrere Arbeitsmodelle entwickelt. Das am meisten verbreitete und beliebteste ist die Gleitzeit. Die oft diskutierte Vertrauensarbeitszeit hingegen stößt in Österreich an rechtliche Grenzen. Wir geben Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen flexibler Arbeitszeitgestaltung.
Gleitzeit: Das bewährte Modell der Arbeitszeitflexibilisierung
Die Gleitzeit ermöglicht es Arbeitnehmern, den Beginn und das Ende ihrer täglichen Arbeitszeit innerhalb eines vereinbarten zeitlichen Rahmens selbst zu bestimmen. Dieses Modell verbindet persönliche Flexibilität mit der Aussicht auf zusammenhängende Freizeit als Ausgleich für längere Arbeitstage oder -wochen.
Rechtliche Rahmenbedingungen der Gleitzeit
- Die tägliche Normalarbeitszeit darf bis zu 12 Stunden betragen, wenn die Gleitzeitvereinbarung einen ganztägigen Verbrauch von Zeitguthaben ermöglicht und dieser in Verbindung mit der wöchentlichen Ruhezeit nicht ausgeschlossen ist.
- Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Normalarbeitszeit auf maximal 10 Stunden pro Tag begrenzt.
- Für Gleitzeitvereinbarungen, die vor dem 1. 9. 2018 abgeschlossen wurden, gilt weiterhin die 10-Stunden-Grenze.
Formelle Anforderungen an die Gleitzeitvereinbarung
Eine Gleitzeitvereinbarung muss zwingend schriftlich erfolgen. In Unternehmen mit Betriebsrat ist eine Betriebsvereinbarung erforderlich, in Betrieben ohne Betriebsrat muss eine schriftliche Einzelvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer getroffen werden. Die Vereinbarung muss folgende Punkte zwingend enthalten:
- Dauer der Gleitzeitperiode (z. B. Monat oder Quartal)
- Gleitzeitrahmen (z. B. 7 bis 19 Uhr)
- Höchstausmaß der Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben und -schulden
- Ausmaß und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit
Besonderheiten und praktische Herausforderungen bei Gleitzeit
Ein wichtiger Aspekt bei der Gleitzeit ist die korrekte Behandlung von Mehr- und Überstunden. Diese müssen gesondert erfasst und abgerechnet werden und dürfen nicht mit dem normalen Gleitzeitguthaben vermischt werden. Auch Arztbesuche haben eine besondere Stellung: Fällt ein notwendiger Arztbesuch in die fiktive Normalarbeitszeit und ist er außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich, gilt er als Dienstverhinderung und damit als Arbeitszeit.
Vertrauensarbeitszeit: Rechtlich begrenzt in Österreich
Das Konzept der Vertrauensarbeitszeit, bei dem Mitarbeiter ihre Arbeitszeit völlig eigenverantwortlich gestalten und keine formelle Zeiterfassung erfolgt, ist in Österreich grundsätzlich nicht mit der geltenden Rechtslage vereinbar. Die Hauptgründe dafür sind:
- Die gesetzliche Pflicht zur Arbeitszeiterfassung (§ 26 AZG)
- Die Verantwortung des Arbeitgebers für die Einhaltung der Höchstarbeitszeiten
- Der gesetzlich verankerte Arbeitnehmerschutz
- Die Notwendigkeit der Dokumentation von Überstunden und deren korrekter Entlohnung
Ausnahmen bestehen lediglich für Leitende Angestellte im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 8 AZG, Arbeitnehmer mit maßgeblicher selbständiger Entscheidungsbefugnis und nahe Angehörige des Arbeitgebers.
Alternativen zur Vertrauensarbeitszeit
Um Beschäftigten trotzdem ein Höchstmaß an Flexibilität zu ermöglichen, empfiehlt sich eine Kombination aus großzügiger Gleitzeit und Home Office. Wichtig dabei ist aber, dass weiterhin die gesetzlichen Vorgaben zur Arbeitszeiterfassung eingehalten werden. Im Home Office reicht die Erfassung der täglichen Gesamtarbeitszeit, sprich ein Tagessaldo.
Praktische Umsetzungstipps für Arbeitgeber
- Zielvereinbarungen und Erwartungsmanagement: Setzen Sie regelmäßige Mitarbeitergespräche an, zum Beispiel monatlich oder zumindest quartalsweise. Achten Sie auf eine ganz klare Definition von Arbeitszielen und Deadlines, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nicht nachweisen, wann sie arbeiten, sondern beweisen, dass sie arbeiten. Kommunizieren Sie als Vorgesetzte oder Vorgesetzter Ihre Erwartungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klar und transparent.
- Flexible Rahmenbedingungen: Führen Sie einen größeren Gleitzeitrahmen ein. Zum Beispiel von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr abends. Verzichten Sie auf die Vorgabe starrer Kernzeiten und etablieren Sie großzügige Durchrechnungszeiträume von bis zu einem Jahr. Auch sollten Sie Home Office und Telearbeit ermöglichen, und zwar ohne „Bauchweh“.
- Arbeitszeitgestaltung: Auch in Sachen Arbeitszeitgestaltung können Sie als Arbeitgeber mehr Flexibilität ermöglichen. Nutzen Sie zum Beispiel die 12-Stunden-Option bei der Normalarbeitszeit, führen Sie flexible Überstundenregelungen ein und geben Sie großzügigere Limits bei Zeitguthaben. Auch die Möglichkeit zu ein ganztägigen statt stundenweisen Zeitausgleich schafft zusätzliche Freiheiten.
- Kommunikation und Vertrauen: Erstellen Sie klare firmeninterne Kommunikationsregeln statt starrer Erreichbarkeitszeiten und ermöglichen Sie regelmäßige Feedback-Gespräche. Legen Sie Ihren Fokus auf Ergebnisse statt Anwesenheit. Was nutzt ein körperlich anwesender Mitarbeiter, der nicht arbeitet?
Auch wenn die klassische Vertrauensarbeitszeit in Österreich rechtlich nicht möglich ist, lassen sich durch eine geschickte Kombination aus flexibler Gleitzeit und Homeoffice-Regelungen moderne und mitarbeiterfreundliche Arbeitszeitmodelle gestalten. Wichtig ist, dass alle Vereinbarungen schriftlich festgehalten werden und regelmäßige Abstimmungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattfinden. So kann eine vertrauensvolle Arbeitskultur entstehen, die sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeiter als auch den betrieblichen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben gerecht wird.
Die Entwicklung flexibler Arbeitszeitmodelle in der modernen Arbeitswelt ist noch nicht abgeschlossen – neue Arbeitsformen und technologische Möglichkeiten werden auch in Zukunft zu Anpassungen und neuen Entwicklungen führen. Dabei wird es wichtig sein, den rechtlichen Rahmen zum Schutz der Arbeitnehmer mit den Anforderungen einer modernen Arbeitswelt in Einklang zu bringen.
Foto: mapo / stock.adobe.com